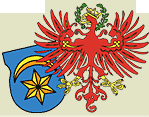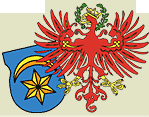|
|
Unsere Tracht
|
Kurzfassung der Forschungsarbeit der
Jahre 1998 bis 2005 – von Peter Kofler
|
Die Schützenkompanie Tramin stand vor einigen Jahren
vor der Entscheidung entweder die seit dem Jahre 1959
getragene Tracht, die bereits etwas heruntergekommen
war, rundum zu erneuern oder auf eine wirkliche historische
Tracht zurückzugreifen. Mit Hilfe der Ergebnisse aus
der hier, sehr verkürzt wiedergegebenen Forschungsarbeit
von mehreren Jahren, konnte die bis jetzt einzig belegbare
Männertracht Tramins rekonstruiert werden.
unsere 'neue' Tracht
 Lange Zeit vermutete ich, dass es sich bei der, vor dem
1. Weltkrieg getragenen Schützentracht, die sich von der
ab 1959 getragenen Tracht in nur wenigen Punkten unterscheidet,
um die historische Traminer Dorftracht handeln
muss. Dies umso mehr, da in einem Zeitungsartikel
aus dem "Tiroler Volksblatt" vom 3. Oktober 1896 von der
"Errichtung einer Traminer Schützenkompanie in der alten
hiesigen Nationaltracht" die Rede ist. In einem später
entdeckten Zeitungsartikel derselben Zeitung geht aber
eindeutig hervor, dass es sich bei dieser "alten hiesigen
Nationaltracht" um eine Übernahme der Tracht der Bozner
Reservistenkolonne handelte. Diese Reservistenkolonne
von Bozen wiederum trug eine Rittnertracht! So etablierte
sich also in Tramin, wo die historische Tracht schon
um die Mitte des 19. Jahrhunderts ausgestorben war, im
Jahre 1896 eine falsche Tracht! In allen Teilen entspricht
diese Tracht ihrem Rittner Ursprung mit Ausnahme der
"Joppe". Während die Rittner Joppe keine Knöpfe und
Rückenfalten aufweist, sind diese auf der Traminer Joppe
aber vorhanden, darüber hinaus wirkt diese Joppe so, als
wäre sie von einem längeren Rock abgeschnitten worden
Auf diese Tatsache machte mich der Traminer Trachtenschneider
Kurt Paizoni aufmerksam. Demnach muss sich
der Schneider der Traminer Schützentracht aus dem Jahre
1896 von einem braunen Tuchrock einer älteren Tracht
beeinflussen haben lassen.
Lange Zeit vermutete ich, dass es sich bei der, vor dem
1. Weltkrieg getragenen Schützentracht, die sich von der
ab 1959 getragenen Tracht in nur wenigen Punkten unterscheidet,
um die historische Traminer Dorftracht handeln
muss. Dies umso mehr, da in einem Zeitungsartikel
aus dem "Tiroler Volksblatt" vom 3. Oktober 1896 von der
"Errichtung einer Traminer Schützenkompanie in der alten
hiesigen Nationaltracht" die Rede ist. In einem später
entdeckten Zeitungsartikel derselben Zeitung geht aber
eindeutig hervor, dass es sich bei dieser "alten hiesigen
Nationaltracht" um eine Übernahme der Tracht der Bozner
Reservistenkolonne handelte. Diese Reservistenkolonne
von Bozen wiederum trug eine Rittnertracht! So etablierte
sich also in Tramin, wo die historische Tracht schon
um die Mitte des 19. Jahrhunderts ausgestorben war, im
Jahre 1896 eine falsche Tracht! In allen Teilen entspricht
diese Tracht ihrem Rittner Ursprung mit Ausnahme der
"Joppe". Während die Rittner Joppe keine Knöpfe und
Rückenfalten aufweist, sind diese auf der Traminer Joppe
aber vorhanden, darüber hinaus wirkt diese Joppe so, als
wäre sie von einem längeren Rock abgeschnitten worden
Auf diese Tatsache machte mich der Traminer Trachtenschneider
Kurt Paizoni aufmerksam. Demnach muss sich
der Schneider der Traminer Schützentracht aus dem Jahre
1896 von einem braunen Tuchrock einer älteren Tracht
beeinflussen haben lassen.
Diesen braunen Tuchrock samt der dazugehörigen historischen
Tracht fand ich dann auch auf alten Votivbildern
und Schützenscheiben in den unmittelbaren Nachbargemeinden
Tramins abgebildet. Während man dort auf
reichliches Bildmaterial zurückgreifen kann, ist solches in
Tramin leider nicht vorhanden. So konnte in Tramin, das
eine alte Schützentradition aufzuweisen hat, keine einzige
historische Schützenscheibe aus dem 18. und frühen
19. Jahrhundert ausfindig gemacht werden. Die Schützenscheiben
und sonstiges historisches Material über das
Traminer Schützenwesen dürften nämlich dem Brand im
Traminer Schießstand im Jahre 1848 zum Opfer gefallen
sein. Auch Votivbilder (Weihebilder in Wallfahrtskirchen)
waren in Tramin keine aufzufinden. Die einstige Traminer
Wallfahrtskirche zu "Unserer lieben Frau zu Tramin"
fiel, wie unzählige andere Sakralgebäude auch, den Josephinischen
Reformen zum Opfer, den Rest erledigte der
Höllentalbach, der die Kapelle zu Beginn des 19. Jahrhunderts
während einer Unwetterkatastrophe übermannshoch
eingrub.
Votivbild in der Wallfahrtskirche von
Kurtatsch aus dem Jahre 1746.
 Gab es in Tramin zwar kein bildliches, so gab es aber reichliches
schriftliches Quellenmaterial in alten Inventarlisten.
Auf diese Listen führte mich eine Forschungsarbeit meines
verstorbenen Großonkels, des Innsbrucker Oberschulrates
Anton Maran, im Schlern des Jahres 1951 (25. Jahrgang),
in der er versuchte die historische Kalterer Frauentracht
anhand einer Inventarliste aus dem Jahre 1750 zu erörtern.
Diese Inventarlisten befinden sich in den so genannten
"Verfachbüchern" der alten tirolischen Gerichte die
heute im Südtiroler Landesarchiv in Bozen aufbewahrt
werden. Gemäß den Landesordnungen der Jahre 1532
und 1573 zufolge, hatten die Gerichte bei Todesfällen die
Erb- und Verlassenschaft zu inventarisieren und an die
Erben zu übergeben. Für die Trachtenforschung besonders
wertvoll sind hierbei die Aufzählungen des Leibgewandes
der Verstorbenen, das neben einer detaillierten Beschreibung
auch noch den damals geschätzten Wertpreis
aufweist. Erst diese detaillierten Beschreibungen in den
Inventarlisten der Traminer "Verfachbücher", die ich in
wochenlanger Arbeit im Landesarchiv in Bozen durchstöbert
habe, gaben mir die endgültige Gewissheit. So konnte
nach längerer Forschungsarbeit die in Tramin getragene
Männertracht rekonstruiert werden und darüber hinaus
auch noch eine verschollene Trachtenlandschaft ähnlich
der des Burggrafenamtes wieder entdeckt werden. Denn
tatsächlich bildete die Gegend von Eppan, Kaltern, Tramin,
Kurtatsch und Margreid eine Art Trachtenlandschaft. Die
in den Traminer Inventaren des 18. Jahrhunderts wiedergegebenen
Kleidungsstücke entsprechen nämlich nicht
nur den besagten bildlichen Darstellungen auf Votivbildern
und Schützenscheiben der Nachbardörfer, sondern
auch den, in den alten "Verfachbüchern" dieser Nachbardörfer
enthaltenen inventarisierten Kleidungsstücken!
Der Ursprung dieser mehr oder minder einheitlichen
Trachtenlandschaft kann weder eindeutig auf politische
noch eindeutig auf kirchliche Gebietseinteilungen zurückgeführt
werden. Im Falle der genannten Ortschaften
kann man nämlich nicht, wie häufig in der Trachtenforschung
üblich, von Gerichtstrachten, also von Trachten
die sich innerhalb der Grenzen eines Gerichtes (alttirolische
Gerichts- und Verwaltungseinheit) entwickelt haben,
sprechen. Denn tatsächlich unterteilte sich die Landschaft
zwischen Eppan und Margreid in vier große Gerichte, in
das landesfürstliche Gericht von Altenburg und Eppan, in
das landesfürstliche Gericht von Kaltern und Laimburg,
in das, bis zum Jahre 1779, fürstbischöfliche Gericht Tramin
und in das landesfürstliche Gericht Kurtatsch. Auch
die alten Pfarreien, die von einigen Trachtenforschern als
Heimstatt von Trachten gesehen werden, haben im Falle
von Tramin und seinen Nachbardörfern keinen Einfluss
geübt, denn die Tracht fand hier, über kirchliche Grenzen
hinweg, ihre Ausbreitung. Grundsätzlich spiegelt eine
Trachtenlandschaft auch den Lauf und die Geschichte
einer Gebietsbesiedelung wieder, bezeugt den
Reichtum bzw. die finanziellen Mittel der Bewohner
einer Gegend, beweist Geschmack,
Geschmacklosigkeit und Schönheitssinn, oft
auch Nachahmungs- und Modesinn derselben.
Die Gegend von Tramin und seiner Nachbardörfer
war natürlich, bedingt durch die relative
Nähe zur Stadt Bozen und aufgrund ihres
Daseins als Durchzugsgebiet empfänglicher
für den Einfluss städtischer, modischer
Gewänder, als Beispielsweise
Ortschaften im Gebirge.
Gab es in Tramin zwar kein bildliches, so gab es aber reichliches
schriftliches Quellenmaterial in alten Inventarlisten.
Auf diese Listen führte mich eine Forschungsarbeit meines
verstorbenen Großonkels, des Innsbrucker Oberschulrates
Anton Maran, im Schlern des Jahres 1951 (25. Jahrgang),
in der er versuchte die historische Kalterer Frauentracht
anhand einer Inventarliste aus dem Jahre 1750 zu erörtern.
Diese Inventarlisten befinden sich in den so genannten
"Verfachbüchern" der alten tirolischen Gerichte die
heute im Südtiroler Landesarchiv in Bozen aufbewahrt
werden. Gemäß den Landesordnungen der Jahre 1532
und 1573 zufolge, hatten die Gerichte bei Todesfällen die
Erb- und Verlassenschaft zu inventarisieren und an die
Erben zu übergeben. Für die Trachtenforschung besonders
wertvoll sind hierbei die Aufzählungen des Leibgewandes
der Verstorbenen, das neben einer detaillierten Beschreibung
auch noch den damals geschätzten Wertpreis
aufweist. Erst diese detaillierten Beschreibungen in den
Inventarlisten der Traminer "Verfachbücher", die ich in
wochenlanger Arbeit im Landesarchiv in Bozen durchstöbert
habe, gaben mir die endgültige Gewissheit. So konnte
nach längerer Forschungsarbeit die in Tramin getragene
Männertracht rekonstruiert werden und darüber hinaus
auch noch eine verschollene Trachtenlandschaft ähnlich
der des Burggrafenamtes wieder entdeckt werden. Denn
tatsächlich bildete die Gegend von Eppan, Kaltern, Tramin,
Kurtatsch und Margreid eine Art Trachtenlandschaft. Die
in den Traminer Inventaren des 18. Jahrhunderts wiedergegebenen
Kleidungsstücke entsprechen nämlich nicht
nur den besagten bildlichen Darstellungen auf Votivbildern
und Schützenscheiben der Nachbardörfer, sondern
auch den, in den alten "Verfachbüchern" dieser Nachbardörfer
enthaltenen inventarisierten Kleidungsstücken!
Der Ursprung dieser mehr oder minder einheitlichen
Trachtenlandschaft kann weder eindeutig auf politische
noch eindeutig auf kirchliche Gebietseinteilungen zurückgeführt
werden. Im Falle der genannten Ortschaften
kann man nämlich nicht, wie häufig in der Trachtenforschung
üblich, von Gerichtstrachten, also von Trachten
die sich innerhalb der Grenzen eines Gerichtes (alttirolische
Gerichts- und Verwaltungseinheit) entwickelt haben,
sprechen. Denn tatsächlich unterteilte sich die Landschaft
zwischen Eppan und Margreid in vier große Gerichte, in
das landesfürstliche Gericht von Altenburg und Eppan, in
das landesfürstliche Gericht von Kaltern und Laimburg,
in das, bis zum Jahre 1779, fürstbischöfliche Gericht Tramin
und in das landesfürstliche Gericht Kurtatsch. Auch
die alten Pfarreien, die von einigen Trachtenforschern als
Heimstatt von Trachten gesehen werden, haben im Falle
von Tramin und seinen Nachbardörfern keinen Einfluss
geübt, denn die Tracht fand hier, über kirchliche Grenzen
hinweg, ihre Ausbreitung. Grundsätzlich spiegelt eine
Trachtenlandschaft auch den Lauf und die Geschichte
einer Gebietsbesiedelung wieder, bezeugt den
Reichtum bzw. die finanziellen Mittel der Bewohner
einer Gegend, beweist Geschmack,
Geschmacklosigkeit und Schönheitssinn, oft
auch Nachahmungs- und Modesinn derselben.
Die Gegend von Tramin und seiner Nachbardörfer
war natürlich, bedingt durch die relative
Nähe zur Stadt Bozen und aufgrund ihres
Daseins als Durchzugsgebiet empfänglicher
für den Einfluss städtischer, modischer
Gewänder, als Beispielsweise
Ortschaften im Gebirge.
Eine Kalterer Schützenscheibe
aus dem Jahre 1768.

Das Traminer "Leibgwand"
Bei der Tracht oder dem "Leibgewand" oder
"Gwand", wie es von den Trägern eigentlich
genannt wurde, handelt es sich um
die, im Gegensatz zur städtischen Mode,
zeitlosere Kleidung der ländlichen, nicht
adeligen Bevölkerung, welche sich im
späten 17. Jahrhundert entwickelt hat.
Dieses Gewand wurde vom Großteil aller
Berufs- und Standesschichten ob es sich
hierbei um Saltner, Bauer, Baumann (eine
Art landwirtschaftlicher Pächter), Händler,
Gastwirt oder Handwerker handelte, gleichermaßen
getragen. Eine andersfarbige oder geartete Kleidung, wie
die Masse der Traminer Bevölkerung sie trug, wurde nur
von Neuankömmlingen, die aus Gegenden mit anderem
Kleidungsbrauch stammten und von Leuten aus Berufsständen
die aus rein praktischen Gründen genötigt waren
sich andersfarbig zu kleiden, getragen. Zu letzteren
gehörte Beispielsweise der Traminer Müller, der bedingt
durch seine Arbeit, keinen für die Traminer Gegend so typischen
braunen Rock tragen konnte und daher, um nicht
ständig durch das weiße Mehl beschmutzt
werden zu müssen, auf einen weißen Rock
auswich. Bei den gleichfarbigen
Kleidungsstücken, die wie
erwähnt von der großen Masse
der Dorfbevölkerung getragen
wurden, gab es auch Unterschiede,
aber lediglich in der Güte der Kleidungsmaterialien.
Diese Unterschiede, die auch
den Reichtum des jeweiligen Trägers erkennen ließen,
waren jedoch bezeichnend für das damalige Leibgewand.
Auch was die Unterscheidung der Kleidungsstücke in ein
Werktags-, Sonntags- oder gar Festtagsgewand betrifft,
so konnten sich nur die Wenigsten derlei viele Kleidungsstücke
leisten, dass sie ihre Gewandung den Anlässen gemäß
einteilen konnten.
 Im Übrigen ist die strenge Unterteilung
in Festtags-, Sonntags- und Werktagstracht ein
Phänomen das in dieser Form nur im Sarntal greifbar ist.
Es war grundsätzlich so, dass die neueren, aus besseren
und kostbareren Materialien hergestellten Kleidungsstücke
für den feiertäglichen Gebrauch bestimmt waren und
die alten abgetragenen, aus minderen Materialien verfertigten
oder von der Form her praktischeren Kleidungsstücke
für den Gebrauch am Werktag.
Im Übrigen ist die strenge Unterteilung
in Festtags-, Sonntags- und Werktagstracht ein
Phänomen das in dieser Form nur im Sarntal greifbar ist.
Es war grundsätzlich so, dass die neueren, aus besseren
und kostbareren Materialien hergestellten Kleidungsstücke
für den feiertäglichen Gebrauch bestimmt waren und
die alten abgetragenen, aus minderen Materialien verfertigten
oder von der Form her praktischeren Kleidungsstücke
für den Gebrauch am Werktag.
Dennoch konnte mit Hilfe der Votivbilder und Schützenscheiben,
auf denen sich die Dargestellten im besten
Staat darstellen ließen, und mit Hilfe der, den Bildern
entsprechenden, in den alten Inventaren am teuersten
geschätzten Kleidungsstücke, das fest- und sonntägliche
Gewand der Traminer Männer für eine Wiedereinführung
als Vereinstracht rekonstruiert werden.
Ausschnitt eines Votivbildes in der Wallfahrts-
kirche von Kurtatsch aus dem Jahre 1775.
Die zukünftigen Kleidungsstücke der Traminer Schützen
Die Traminer Schützen tragen weiße Hemden aus feinem
Leinen, die den, in den Inventarlisten als "harben"
bezeichneten Hemden entsprechen. Diese Hemden besitzen
weite und bauschige Ärmel welche an den Achseln
und am Handgelenk stark gefältelt sind und haben einen
schmalen Stehkragen. Um denselben wird die schwarze
seidene Halsbinde (Flor) getragen. Diese wird ein oder
zweimal um den Hals gelegt, vorn zu einer losen Schlinge
gewunden, während beide Enden unter dem Hosenheber
durchgezogen, gemeinsam in die rechte oder in die
linke Achselöffnung des Leibls oder Brusttuches gesteckt
werden. Bis weit über die Mitte des 18. Jahrhunderts bevorzugte
der Traminer die weiße Halsbinde, in den 70er
Jahren des 18. Jahrhunderts trat dann aber die schwarze
Halsbinde an die Stelle der weißen. Über dem Hemd
tragen die Schützen rote Leibl welche am Halsausschnitt
mit Silberborten verbrämt und mit schönen Zinnknöpfen,
die einreihig angebracht sind, bestückt sind. Das, im Gegensatz
zum Brusttuch, städtisch geprägte rote Leibl fand
in Tramin schon sehr früh seine Verbreitung, in diesem
Zusammenhang ist auch der alte, in Tramin
und Kaltern früher häufig nun aber seltener getätigte
Ausspruch, "sich es roate Leibl vr'deanen weïlln"
oder "sich in roatn Loab vr'deanen weïlln" (sich
das rote Leibl verdienen wollen) zu sehen.
Ausschnitt aus dem Votivbild in der Kager-
kapelle in Girlan aus dem Jahre 1797.

Als Hose dient eine "gschmitzte", also schwarz gefärbte Kniebundhose
aus Hirschleder. Diese, in alten Inventaren als "seiten",
"lidern" oder "fellen" bezeichnete Hose geht der Form
nach größtenteils auf die französische "culotte" zurück
und war in Tramin schon zu Ende des 17. Jahrhunderts
allgemein üblich. Wie alte Darstellungen beweisen, besaßen
die meisten dieser Lederhosen keine Zier-Stickereien.
Da die Lederhosen sehr eng waren, schlitzte man die Hosenröhren
an der Außenseite auf, besetzte sie mit Knöpfen
und zog lange Bänder ein. Mit denselben band man
den Kniebund und fixierte auch die leicht verrutschenden
Strümpfe. All diese Kleinigkeiten wurden bei der Verfertigung
der, für die Traminer Schützen bestimmten Hosen,
berücksichtigt.
Die Lederhosen werden von einem grünen
"H- förmigen" Hosenheber, der mittels Hosenheberhaften
aus Messing an der Lederhose angebracht wird, gehalten.
Den Hosenheber gab es in Tramin in zwei Variationen, als
"V- förmigen" und als "H-förmigen" Hosenheber. Beide
Typen wurden Tirolweit getragen, für die unterschiedliche
Wahl muss wohl der jeweilige Geschmack des Trägers
eine Rolle gespielt haben.
Zur ledernen Kniebundhose
werden schmutzigweiße Garnstrümpfe in schönen Modeln
getragen. Diese, mit Mustern versehenen Strümpfe,
erscheinen in den alten Inventaren unter dem Namen
"gweggelte" Strümpfe. Interessanterweise wurden die
Strümpfe, die in mehreren Farben getragen wurden, in
Tramin einst größtenteils gefertigt gekauft und aus Halb
- Europa importiert. So scheinen in dem, am 12. und 13.
März 1756 erstellten Inventar des Traminer Krämerladens
Beispielsweise Hamburger, Erlanger, Memminger, Schwazer,
Englische und Münchner Strümpfe auf.
Bei den neuen Schuhen der Schützenkompanie handelt es
sich um handgefertigte, holzgenagelte, schwarze Schnallenschuhe
mit Zinnschnallen die im Wesentlichen dem
herrschaftlichen Laschen- und Schnallenschuh des Barock
und Rokoko entsprechen. Auf alten Darstellungen und in
den alten Traminer Inventaren, trifft man immer wieder
auf diese sehr städtische Schuhart die grundsätzlich zum
besten Staat getragen wurde. Bei den Zinnschnallen, die
zum neuen Schuh getragen werden, handelt es sich um
handgefertigte Zierschnallen mit stilisierten Verzierungen.
Als Übergewand tragen die Traminer Schützen nun einen
braunen Tuchrock. Die Form desselben geht weitgehend
auf den in Tramin getragenen "Praun Tiechenen Rockh"
zurück. Dieser Rock entwickelte sich aus dem "Justaucorps",
den französischen Staatsrock des späten 17. Jahrhunderts.
Entsprechend der "Regencemode" (1715-1730)
die auch auf den bäuerlich - ländlichen Rock ihre Auswirkung
zeigte, ist auch der Rock der Schützenkompanie
schön anliegend gearbeitet. Neben der Taillierung trifft
man am Rücken die, meist ab der Taille, aufspringenden
Falten an, die dem Rock Lebhaftigkeit verleihen. Auffallend
an diesem Rock, sind auch die Stülpärmel und die
reichliche Besetzung mit Knöpfen aus Zinn. Die Rockknöpfe
befinden sich nicht nur am vorderen Besatz sondern
auch auf den Stülpärmeln, bzw. den Ärmelaufschlägen
und am oberen Ansatz der aufspringenden Falten
am Rücken. Die Knöpfe dienen der Zierde, denn der Rock
wurde grundsätzlich offen getragen, aus Bequemlichkeit,
aber auch um das darunter getragene, schöne rote Leibl,
den grünen Hosenheber und die Leibbinde zur Schau stellen
zu können.
Als Hut dient den Schützen nun ein großer schwarzer
Scheibenhut aus Filz mit weiter Krempe und einem rundlichen,
beinahe der Kopfform angepassten Gupf. Die Bezeichnung
"Scheibenhut" ist wohl auf die Form des Hutes,
die einer Schützenscheibe sehr nahe kommt, zurückzuführen.
Beim Traminer Hut handelt es sich um einen "eingefassten"
Hut wie es ihn im Krämerladen um 34 Kreuzer
zu kaufen gab. Die Hüte wurden in Tramin zur Mitte des
18. Jahrhunderts vom Krämer von auswärts angekauft
und im Krämerladen verkauft, einen ortsansässigen Hutmacher
wie es Beispielsweise um 1778 in Kaltern einen
gab, konnte in Tramin nicht nachgewiesen werden. Beim
"eingefassten Hut" ist der untere "Flügenrand", also die
Unterseite der Hutkrempe, mit einem breiten schwarzen
Seidenband, das in Tramin als "Taftband" bezeichnet wurde,
besetzt (eingefasst). Das "Taftband" reicht vom äußersten
unteren "Flügenrand" bis zur Mitte des Gupfkopfes
(Loch für den Kopf des Trägers). Den Abschluss des "Taftbandes"
nach Innen hin bildet eine Borte. Der eigentliche
Gupfkopf ist mit einem roten Gupffutter, das in Tramin
als "Schetter - Leinwand" bezeichnet wurde, ausstaffiert.
Als Zierde umgibt den Hut ein breites schwarzes Seidenband,
welches am Gupf angebracht ist und um denselben
rundherum verläuft. Am hinteren Ende des Gupfes,
wo sich die Umfassung des Seidenbandes schließt, fallen
die zwei losen Enden nach hinten über den "Flügenrand"
herab und enden dort in schwarzen Fransen. Aufgrund
dieser Bänder die am Hut angebracht sind, wurde diese
Hutart auch "Bänderhut" genannt. Zu diesem Seidenband
kommt noch eine kleine schmale goldene Hutschnur die
den Abschluss der schwarzen Hutbänder am Übergang
vom Gupf zur Krempe markiert. Die Hüte der Traminer
Schützen sind nicht, wie bei Schützen oft üblich, an der
Seite aufgebogen (aufgekrempt). Einen nicht aufgebogenen
Hut trugen Beispielsweise auch die "Bozner Bauernschützen"
(Schützen aus dem Landgericht Bozen - Gries)
von denen es sehr viele Darstellungen gibt und die eine,
der Traminer Gegend ähnliche Tracht trugen. Als Federschmuck
tragen die Traminer Schützen nun einen halben
Spielhahnstoß an der rechten Seite des Hutes.
Früher trugen einige Traminer zu ihrem Gewand Leibbinden
aus Leder, wobei viele dieser Leibbinden mit Metallnägeln
aus Zinn und vereinzelt auch aus Messing beschlagen
waren, deren Anordnung verschiedene Figuren
formten, wie Beispielsweise den Kaiseradler, Blumen oder
stilisierte Musterformen. Die heutigen Traminer Schützen
behalten ihre alten, mit Federkiel gestickten Leibbinden
aus den Jahren 1896 und 1959 bei, wobei zu hoffen ist,
dass zukünftig vereinzelt auch wieder "weiß gspängelte"
Binden, also mit Zinnstiften verzierte Leibbinden getragen
werden. Verschiedene Leibbinden innerhalb eines
Vereins sind zu begrüßen, denn die Leibbinde war immer
schon ein Hauptmerkmal der Individualität einer Tracht
und ihres Trägers und früher war es tatsächlich so, das
nur derjenige, der es sich leisten konnte, eine solche besaß
und auch trug.
Zur Realisierung der historischen Traminer Männertracht
haben mehrere Betriebe beigetragen:
Der Rock und das Leibl wurden aus dem feinen Tuchloden
der Brunecker Tuchfabrik Moessmer vom Traminer
Trachtenschneider Kurt Paizoni angefertigt. Die Hüte
stammen von der Firma Hutter in Meran, die Lederhosen
von der Firma Gebhard in Brixen und die Trachtenhemden
und Halsbinden von der Trachtenschneiderei Burgl Nock
in Lana. Die Strümpfe wurden von der Strickboutique in
Eppan, die Schuhe vom Schustermeister Roland Dibiasi in
Kurtatsch und die Schuhschnallen und Federhalter vom
Zinn- und Messinggurte - Hersteller Josef Leitner in Milland
gefertigt.
Allen Handwerkern sei hiermit für ihre Geduld, ihre Detailtreue
und ihr historisches Gespür recht herzlich gedankt!
|
|
 |
die Festschrift zum
Downloaden!
Die Trocht isch a Gwond
deïs gwochsn isch in Lond.
Ibroll schaug deïs Gwandl
a bissl ondersch aus,
obr ibroll druckts die gleiche
Liab zur Hoamat aus.
Peter Kofler, 2002
|
 |
|